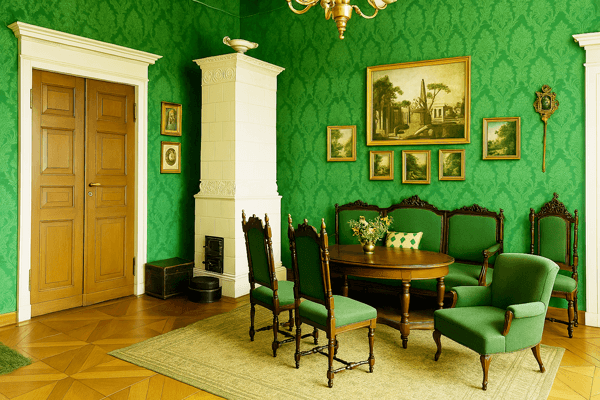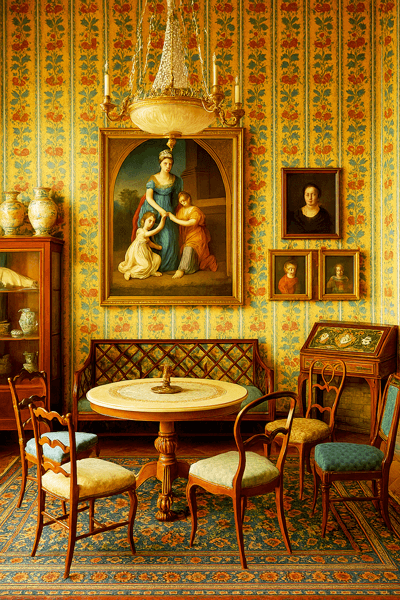Die Burg Angern als Herrschafts- und Wehranlage stellt in ihrer historischen Entwicklung ein typisches Beispiel einer spätmittelalterlichen Wasserburg des niederen Adels im mitteldeutschen Raum dar. Ihre Entstehung unter Erzbischof Otto von Magdeburg im 14. Jahrhundert war eng mit den Machtinteressen des Erzstifts Magdeburg verbunden. Die Wahl des Standorts – auf einer inselartigen Erhebung inmitten der Elbniederung – folgte sowohl militärisch-strategischen als auch wirtschaftlich-topographischen Überlegungen. In unmittelbarer Nähe wichtiger Verkehrswege und Elbübergänge gelegen, diente die Burg der Kontrolle von Handelsrouten, der Sicherung regionaler Besitzverhältnisse und der symbolischen Machtdemonstration.
Die funktionale Dreigliederung der Anlage – Hauptinsel mit Wohn- und Verwaltungsbauten, Turminsel mit Wehrfunktion, festlandseitige Vorburg mit Wirtschaftsstruktur – entsprach dem etablierten Burgentypus in der norddeutschen Tiefebene. Der Bergfried mit Schießscharte(n), das massive Pforthäuschen am Brückenkopf und die Bruchsteingewölbe auf der Ostseite der Hauptinsel belegen die defensive Ausrichtung und die bauliche Qualität der mittelalterlichen Kernburg.
Zugleich war Angern über weite Strecken des 15. und 16. Jahrhunderts ein bedeutender Verwaltungsmittelpunkt der Familie von der Schulenburg. Die Nutzung des Gebäudekomplexes reichte von militärischer Station über repräsentativen Wohnsitz bis hin zu einem regionalen Gutshof mit Brauerei, Stallungen und Vorratswirtschaft.
Die Zerstörung der Anlage im Jahr 1631 während des Dreißigjährigen Kriegs stellt eine Zäsur dar. Die Wiederverwendung einzelner Strukturen – insbesondere der erhaltenen Tonnengewölbe, des Turmerdgeschosses und des Pforthäuschens – belegt jedoch, dass das Gelände auch im 17. Jahrhundert nicht vollständig aufgegeben wurde. Der Wiederaufbau ab 1650 integrierte Reste der mittelalterlichen Bausubstanz in eine neue, wirtschaftlich orientierte Gutshofstruktur mit reduzierter Wehrfunktion.
Die Burg Angern vereinte somit auf engem Raum die drei Grundfunktionen adliger Herrschaft im Spätmittelalter: Wehrhaftigkeit, wirtschaftliche Autonomie und territoriale Präsenz. Ihre Bau- und Besitzgeschichte, ergänzt durch archäologische Befunde und schriftliche Quellen, macht sie zu einem Schlüsselobjekt für die Erforschung des Burgenwesens in der südlichen Altmark.

Ansicht des Erdgeschosses der Burg auf der ersten Insel mit teils verschütteten Gewölben