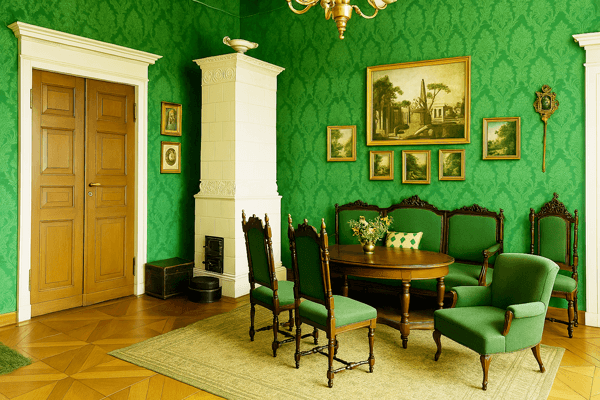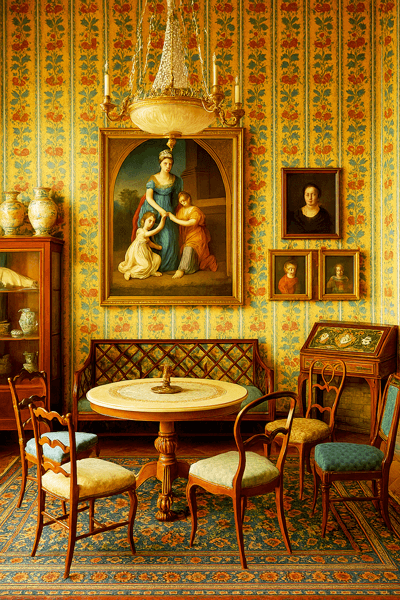Im 14. Jahrhundert war die Altmark Schauplatz konkurrierender Herrschaftsansprüche. Die Markgrafen von Brandenburg, das Erzbistum Magdeburg und verschiedene Adelsfamilien wie die von Alvensleben und von Grieben rangen um Besitz, Lehensrechte und lokale Macht. Die Gründung der Burg in Angern diente der Erzdiözese Magdeburg zur militärischen Sicherung und verwaltungstechnischen Kontrolle ihrer südaltmärkischen Besitzungen. Die Anlage einer Wasserburg mit Wehr- und Wohnfunktion manifestierte die landesherrliche Präsenz in einem territorial instabilen Raum.
Die Gründung der Burg Angern im Jahr 1341 wird allgemein mit dem Namen Otto von Hessen (1292–1369), Erzbischof von Magdeburg seit 1327, in Verbindung gebracht. Ob es sich dabei um einen Neubau oder die Verstärkung einer bereits vorhandenen Anlage handelte, ist unklar. Die Burg war von einem tiefen Graben umgeben und verfügte über einen siebenstöckigen Turm, der das Bauwerk dominierte. Es handelte sich wahrscheinlich um einen Bruchsteinbau, wie die Mauerreste an der Brücke vermuten lassen. Als Landesherr und geistliches Oberhaupt in einem der umkämpftesten Territorien des mitteldeutschen Raumes verfolgte Otto von Magdeburg eine konsequente Territorialpolitik zur Festigung der erzbischöflichen Macht in der Altmark. Die Entscheidung für einen Burgneubau in Angern ist im Kontext der politischen, wirtschaftlichen und geographischen Gegebenheiten des 14. Jahrhunderts zu verstehen. Die Burg wurde erstmals 1336 urkundlich erwähnt, als es zwischen dem Erzbischof von Magdeburg und dem Markgrafen von Brandenburg zu einer Einigung über die Besitzverhältnisse in der südlichen Altmark kam.
Die Wahl Angerns als Standort resultierte aus mehreren Faktoren: Die geografische Nähe zur Elbe, rund fünf Kilometer westlich, ermöglichte eine indirekte Kontrolle über Flussübergänge und Handelswege. Die Burg lag an einem sekundären Nord-Süd-Korridor zwischen Tangermünde, Rogätz, Burgstall und Magdeburg. Die militärische Relevanz der Region belegen auch die Ereignisse des Dreißigjährigen Kriegs, als Angern mehrfach von Truppen besetzt wurde. Somit war die Burg als Kontrollpunkt für Personen- und Warenverkehr sowie als Vorposten gegen mögliche Übergriffe auf das Kerngebiet des Erzstifts zu verstehen (vgl. Schulze 1995, S. 218).
Symbolisch stellte die Burg Angern auch ein Machtsignal dar: Als erzbischöflicher Neubau überformte sie vermutlich ältere adlige Besitzstrukturen. Noch 1370 finden sich Belehnungen an Söhne des Ritters Jakob von Eichendorf, 1373 tritt Gebhard von Alvensleben als Lehnsherr auf. Die Burg wurde somit nicht nur als Amtssitz, sondern auch als Machtinstrument in einem lokalen Lehenskonflikt verwendet.
Zusammenfassend war die Gründung der Burg Angern durch Erzbischof Otto Teil einer übergeordneten Territorialpolitik des Erzstifts Magdeburg im 14. Jahrhundert. Ihre strategische Lage, topographische Eignung und politische Funktion begründen ihre Bedeutung weit über den regionalen Rahmen hinaus.
Quellen und Literatur:
- Verbandsgemeinde Elbe-Heide: Schloss Angern. Geschichte, online unter www.elbe-heide.de
- Landesarchiv Sachsen-Anhalt, Rep. H Angern Nr. 412
- Ziesemer, Ernst: Die mittelalterlichen Burgen der Altmark. Magdeburg 1994.
- Boockmann, Hartmut: Die Burgen im deutschen Sprachraum. München 2002.
- Schulze, Hans K.: Das Erzbistum Magdeburg und seine Bischöfe im Spätmittelalter. In: Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters, Bd. 51 (1995), S. 201–228.