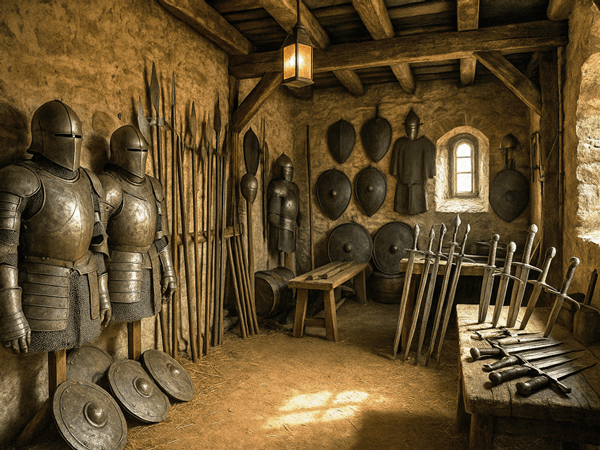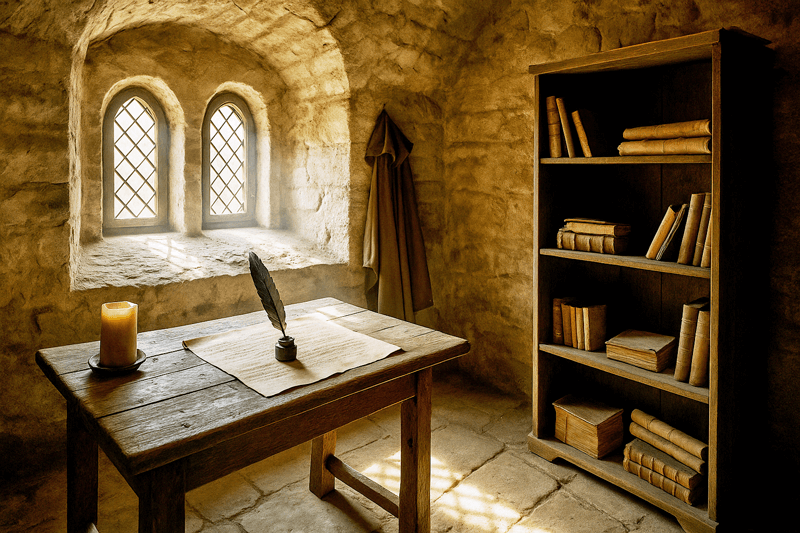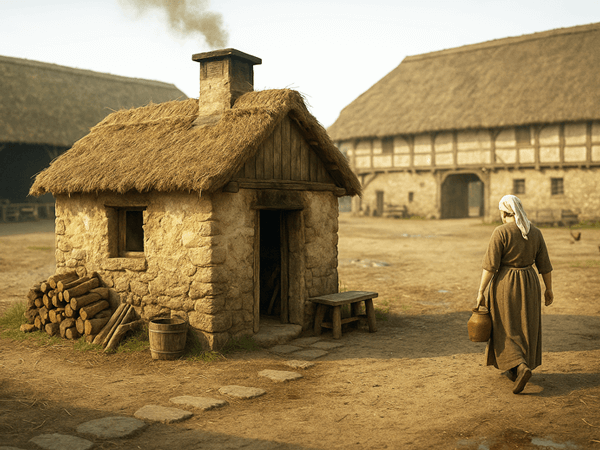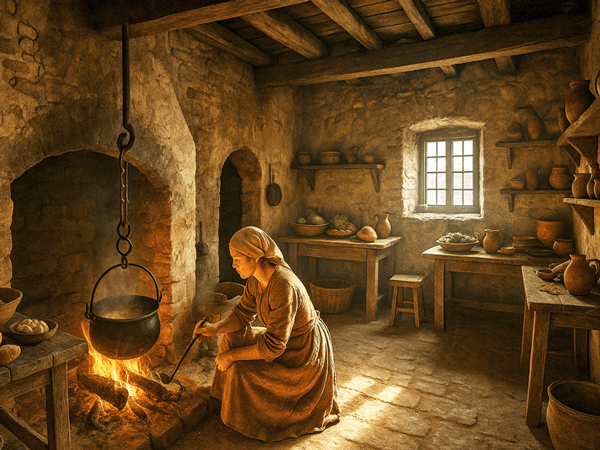Die Fensteröffnungen im östlichen Mauerzug des tonnengewölbten Palas-Erdgeschosses der Burg Angern gehören zu den authentischsten überlieferten Lichtöffnungen hochmittelalterlicher Wasserburgen in der Altmark. Ihre tiefe, trichterförmige Laibung, die segmentbogigen Abschlüsse und originalen Sicherungselemente belegen eine bauzeitliche Entstehung um 1340. Die gezielte Ausrichtung zur Achse des Umkehrgangs verweist auf eine funktional durchdachte Lichtführung, wie sie für nichtrepräsentative Funktionsräume dieser Zeitstellung charakteristisch ist.
Befund B1: Fensteröffnung im nördlichen Raum des Palas
Lage und Raumeinbindung: Die Fensteröffnung befindet sich in der Ostwand des nördlichen tonnengewölbten Erdgeschossraumes des Palas auf der Hauptinsel der Burg Angern. Sie liegt innerhalb der östlichen Ringmauer der Hauptburg. Die Fensteröffnung befindet sich in der Ostwand des südlichen tonnengewölbten Erdgeschossraums des Palas und liegt tief im aufgehenden Mauerwerk der Ringmauer der Hauptburg. Sie ist in eine statisch unkritische Zone außerhalb des Gewölbescheitels eingebunden. Beide Fenster sind asymmetrisch angeordnet: im nördlichen Gewölberaum südlich, im südlichen Raum nördlich versetzt (siehe Befund A6). Diese Positionierung ist statisch sinnvoll, da Öffnungen im Gewölbescheitel die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigt hätten. Die gewählte Lage erlaubt somit eine funktionale Belichtung bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität der Gewölbeschale – ein konstruktives Prinzip, das in der hochmittelalterlichen Kellerarchitektur vielfach belegt ist. Zugleich steht die Öffnung damit in direkter Fluchtlinie zum gegenüberliegenden Eingang des Umkehrgangs, was auf eine gezielte bauzeitliche Lichtführung für diesen ansonsten vollständig fensterlosen Verbindungskorridor hinweist. Durch den Tageslichteinfall in die seitlich angrenzenden Eingänge wurde ein Mindestmaß an Sichtverhältnissen geschaffen, das die Orientierung auch ohne künstliche Lichtquelle erleichterte – ein bauzeitlich durchdachtes Konzept, wie es sonst nur selten nachweisbar ist.
Maße und Form: Die Öffnung besitzt eine annähernd quadratische Lichtweite von ca. 40 × 40 cm. Die Laibung ist konisch nach außen verjüngt, mit einem flach segmentbogigen Sturz. Die Proportion, Ausbildung und Orientierung entsprechen typologisch funktionalen Lichtöffnungen in hochmittelalterlichen Kellerbereichen.
Innenansicht – Konstruktion und Erhaltung: Die Innenansicht zeigt eine tief eingeschnittene, konisch nach außen verjüngte Laibung, die aus hochkant gesetzten Handstrichziegeln besteht. Der flach segmentbogige Sturz ist aus handgefertigten Ziegeln gesetzt, die nicht sichtbar mit dem umgebenden Mauerwerk verzahnt sind. Diese lose Auflagerung, in Kombination mit der gleichzeitig erneuerten Außenlaibung, weist auf eine spätere Reparaturmaßnahme, vermutlich im 19. Jahrhundert, hin. Die Arbeiten erfolgten unter Beibehaltung der ursprünglichen Öffnungsform und unter Verwendung traditioneller, nicht industrieller Ziegel. Die Ziegel zeigen typische Merkmale handwerklicher Fertigung: unregelmäßige Maße, weichkantige Profile und variierende Brenntönungen. Der Putz der inneren Laibung ist insbesondere im oberen Bereich großflächig verloren. Sichtbar sind Erosionsspuren, Materialausbrüche und sekundäre Schädigungen, die auf langanhaltende Feuchtigkeitseinwirkung und spätere Nutzungseinflüsse zurückzuführen sind. Trotz dieser Verluste ist die strukturelle Integrität der Öffnung vollständig erhalten. Es bestehen keine Hinweise auf nachträgliche Erweiterungen oder Durchbrüche. Der bauzeitliche Charakter der Fensterlaibung ist in Anlage, Mauerung und Materialität klar fassbar.

Lichtführung und funktionale Ausrichtung: Das Fenster ist in direkter Fluchtlinie gegenüber dem westlichen Ein- und Ausgang des dazwischenliegenden Umkehrgangs positioniert. Diese gezielte Ausrichtung ermöglichte eine indirekte Belichtung des ansonsten fensterlosen Verbindungsgangs zwischen den beiden Gewölberäumen. Damit belegt der Befund nicht nur eine gezielte Lichtführung für den eigenen Raum, sondern auch eine durchdachte Lichtlenkung zur Orientierung in nachgeordneten Raumeinheiten.
Außenansicht – Überformung: Die äußere Laibung des nördlichen Fensters zeigt deutliche Überformungsspuren aus dem 19. Jahrhundert. Ein in den Sturz eingelassener Ziegel mit der Prägung „Kehnert“ belegt die Herkunft aus der gleichnamigen Ziegelei, die erst im 19. Jahrhundert in Betrieb war. Der flach segmentbogige Sturz besteht aus regelmäßig geformten, industriell gefertigten Ziegeln, die radial gesetzt wurden. Die Fugenverläufe und der Anschluss an das ältere Bruchsteinmauerwerk zeigen charakteristische Bindungsstörungen, darunter unterschiedliche Mörtelstrukturen und Versatzlinien. Diese Befunde sprechen für eine nachträgliche Ausbesserung oder vollständige Neumauerung des äußeren Fassungsbereichs. Die innere Laibung und die ursprüngliche Gewölbestruktur sind davon nicht betroffen und weisen bauzeitliche Substanz um 1340 auf. Die Überformung ist daher als sekundärer Eingriff im Fassungsbereich zu bewerten, der den funktionalen und konstruktiven Charakter der Fensteröffnung jedoch nicht grundlegend verändert hat.

Zusammenfassung: Die Fensteröffnung in der Ostwand des nördlichen tonnengewölbten Erdgeschosses des Palas ist in ihrer inneren Struktur vollständig original erhalten und dokumentiert ein selten überliefertes, funktional konzipiertes Licht- und Belüftungselement des 14. Jahrhunderts. Die äußere Ziegelerneuerung im 19. Jahrhundert ist als nachgeordnete Überformung zu werten. Die gezielte Ausrichtung zur Achse des Umkehrgangs, die archaische Ziegelausführung und die Spuren der Sicherungsvorrichtung machen den Befund zu einem exemplarischen Beleg hochmittelalterlicher Kellerarchitektur in wasserbeeinflusstem Kontext.
Befund B2: Fensteröffnung im südlichen Raum des Palas
Lage und Raumeinbindung: Die Fensteröffnung befindet sich in der Ostwand des südlichen tonnengewölbten Erdgeschossraums des Palas und liegt tief im aufgehenden Mauerwerk der Ringmauer der Hauptburg. Sie ist in eine statisch unkritische Zone außerhalb des Gewölbescheitels eingebunden. Die beiden Fenster sind asymmetrisch angeordnet: im nördlichen Gewölberaum südlich, im südlichen Raum nördlich versetzt. Diese Positionierung ist statisch sinnvoll, da Öffnungen im Gewölbescheitel die Tragfähigkeit der Konstruktion beeinträchtigt hätten. Die gewählte Lage erlaubt somit eine funktionale Belichtung bei gleichzeitiger Wahrung der strukturellen Integrität der Gewölbeschale – ein konstruktives Prinzip, das in der hochmittelalterlichen Kellerarchitektur vielfach belegt ist. Zugleich steht die Öffnung damit in direkter Fluchtlinie zum gegenüberliegenden Eingang des Umkehrgangs, was auf eine gezielte bauzeitliche Lichtführung für diesen ansonsten vollständig fensterlosen Verbindungskorridor hinweist. Durch den Tageslichteinfall in die seitlich angrenzenden Eingänge wurde ein Mindestmaß an Sichtverhältnissen geschaffen, das die Orientierung auch ohne künstliche Lichtquelle erleichterte – ein bauzeitlich durchdachtes Konzept, wie es sonst nur selten nachweisbar ist.
Maße und Form: Die Öffnung besitzt eine annähernd quadratische Lichtweite von ca. 40 × 40 cm. Die Laibung ist konisch eingezogen und nach außen verjüngt. Der Sturz ist als flach segmentbogige Ziegelschicht ausgebildet. Die Einbindung der Laibung in das umgebende Mauerwerk erfolgt ohne Bindungsstörungen. Die Position im unteren Wanddrittel entspricht der typischen Lage funktionsorientierter Belichtungsöffnungen in hochmittelalterlichen Kellerzonen.
Innenansicht – Konstruktion und Erhaltung: Die Laibung des südlichen Fensters ist tief eingezogen und konisch nach außen verjüngt. Die Ausführung erfolgt nicht vollständig in Ziegelmauerwerk, sondern in einem heterogenen Materialverband: Die seitlichen und unteren Flächen bestehen aus unregelmäßig gemauertem Mischmauerwerk, teils mit Mörtelresten und Putzauflagen, teils mit verputztem Bruchstein. Die Laibung ist stark geglättet, aber an mehreren Stellen verwittert, ausgebrochen oder nachträglich ergänzt. Der Sturz ist als monolithischer Segmentbogen ausgeführt, möglicherweise aus Formputz oder aus großformatigen Werksteinen, die mit Kalkmörtel verstrichen wurden. Es sind keine Ziegel im eigentlichen Sturzbereich sichtbar. Die Ausführung wirkt älter, aber deutlich schlichter als beim nördlichen Pendant. Es fehlen formtypische hochmittelalterliche Ziegelmerkmale wie differenzierte Gliederung oder präzise Backsteinversatztechnik. Der Putz im Bereich der Laibung ist unregelmäßig und teilweise flächig erhalten, mit deutlichen Alterserscheinungen: Risse, Ausbrüche und Kalkabsinterungen sind erkennbar. Die untere Fensterbank ist beschädigt und mit Schutt, organischem Material und Nutzungsspuren belegt. Die verzinkten Eisenverankerungen im oberen Bereich sind korrodiert, aber klar original und funktional eingebunden.

Außenansicht und Überformung des nördlichen Fensters: Die Außenseite der östlichen Palasmauer im Bereich des nördlichen Fensters zeigt deutliche Spuren einer späteren Neuaufmauerung. Der ursprüngliche Außenverband ist in diesem Bereich vollständig verloren; stattdessen wurde die Laibung im 19. Jahrhundert mit industriell gefertigten Ziegeln neu gefasst. Der flach segmentbogige Sturz besteht aus regelmäßig geformten, radial gesetzten Ziegeln. Ein Ziegel mit der Prägung „Kehnert“ belegt die Herkunft aus der gleichnamigen Ziegelei, deren Produktion im 19. Jahrhundert nachweisbar ist. Diese Überformung betrifft ausschließlich den Außenbereich. Vier neuzeitliche Bohrlöcher in der äußeren Laibung – vermutlich zur Aufnahme eines späteren Sicherungselements wie eines Gitters – sind deutlich erkennbar. Sie wurden nachträglich eingebracht und weisen weder mittelalterliche Werkzeugspuren noch eine historische Verankerung auf.
Innere Laibung und Bohrungen: Die innere Laibung, die Teil der originalen Ziegelstruktur des Tonnengewölbes ist, blieb vom Mauerdurchbruch unberührt. Sie weist keine sekundären Einfügungen oder Substanzverluste auf und ist durchgehend bauzeitlich – mit typischen Ziegelformaten und Mörteltechnik der Bauphase um 1340.
Baufall und Reparaturkontext: Der Befund spricht für ein lokales Versagen der äußeren Ringmauer im Bereich des Fensters, möglicherweise infolge struktureller Schwächung (z. B. durch Setzungen, Feuchteeintrag oder Kriegseinwirkungen). Der erhaltene innere Wandkern aus bauzeitlichen Ziegeln belegt jedoch die ursprüngliche Tiefe und Lage des Fensters. Die Neuaufmauerung erfolgte funktional korrekt, aber ohne Rücksicht auf die historische Materialität.
Bewertung: Die äußere Laibung samt segmentbogigem Sturz stellt eine sekundäre Rekonstruktion dar, die stilistisch und technologisch dem 19. Jahrhundert zugeordnet werden kann. Die innere Struktur ist hingegen bauzeitlich original und besitzt hohe denkmalpflegerische Relevanz. Die Fensteröffnung selbst ist bauzeitlich angelegt und integraler Bestandteil des ursprünglichen Gewölbes; der spätere Mauerdurchbruch betraf ausschließlich die äußere Fassungsstruktur, nicht jedoch die originale innere Laibung. Die neuzeitlichen Bohrungen sind als spätere Einfügung ohne bauhistorischen Wert zu bewerten. Der Befund liefert ein instruktives Beispiel für den Erhalt mittelalterlicher Substanz trotz späterer Fassadeneingriffe.

Funktionale Bewertung: Die Öffnung diente primär der Belichtung und Belüftung eines funktionalen, nicht repräsentativen Raumes im Bereich des südlichen Gewölbes. Durch die gezielte Position in Fluchtlinie zum Umkehrgang ermöglichte sie gleichzeitig eine indirekte Lichtzufuhr für die Gangzone, wodurch eine minimale Orientierung in einem ansonsten völlig lichtlosen Verbindungskorridor geschaffen wurde.
Literatur
- Wäscher, Hermann: Feudalburgen in den Bezirken Halle und Magdeburg, Bd. 1: Einführung und Katalog, Berlin 1962, S. 42–44.
- Grimm, Paul: Die vor- und frühgeschichtlichen Burgwälle der Bezirke Halle und Magdeburg, Berlin 1958, S. 360, Nr. 904 (Kalbe, Lenzen).
- Dehio, Georg: Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler – Sachsen-Anhalt I: Regierungsbezirk Magdeburg, München/Berlin 2002, S. 91 (Burg Angern), S. 117 (Ziesar).
- Krahe, Friedrich-Wilhelm: Burgen des deutschen Mittelalters, Würzburg 2000, S. 95 (typologische Parallelen zu Belichtungs- und Sicherungsfenstern in Kellerzonen).