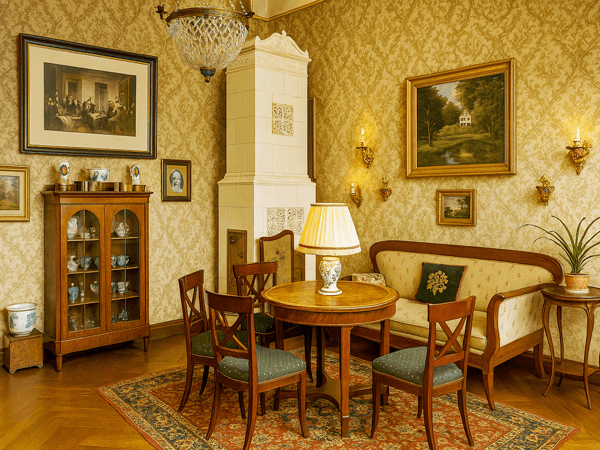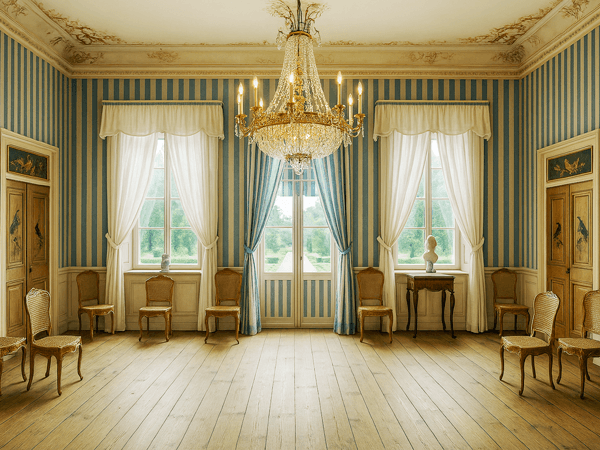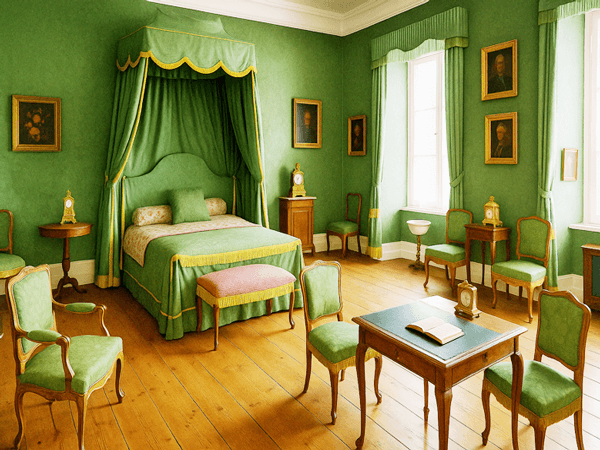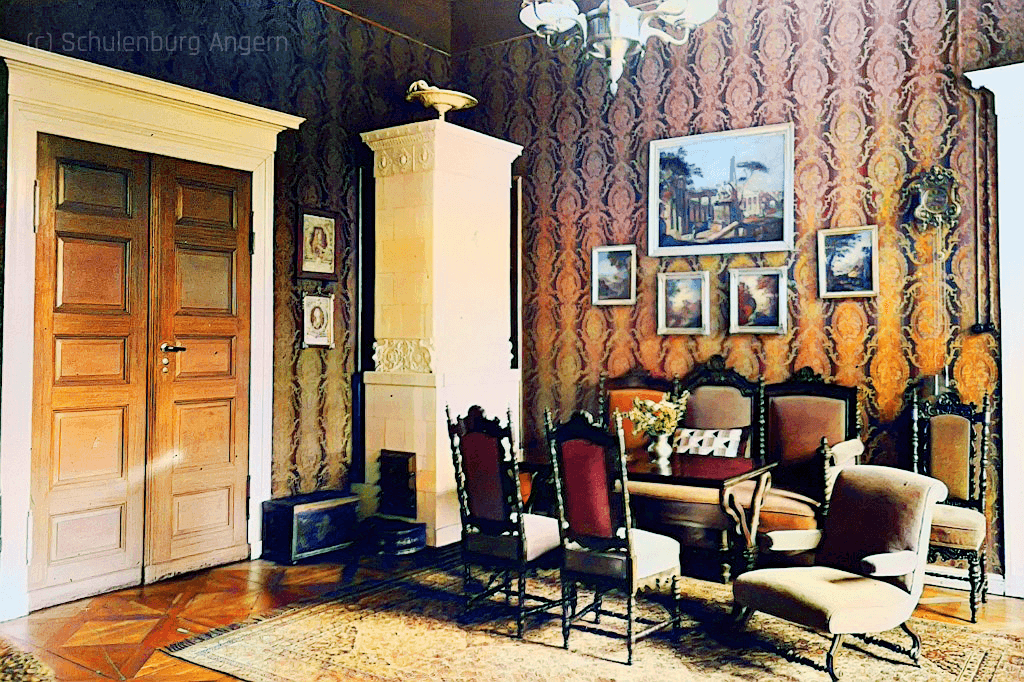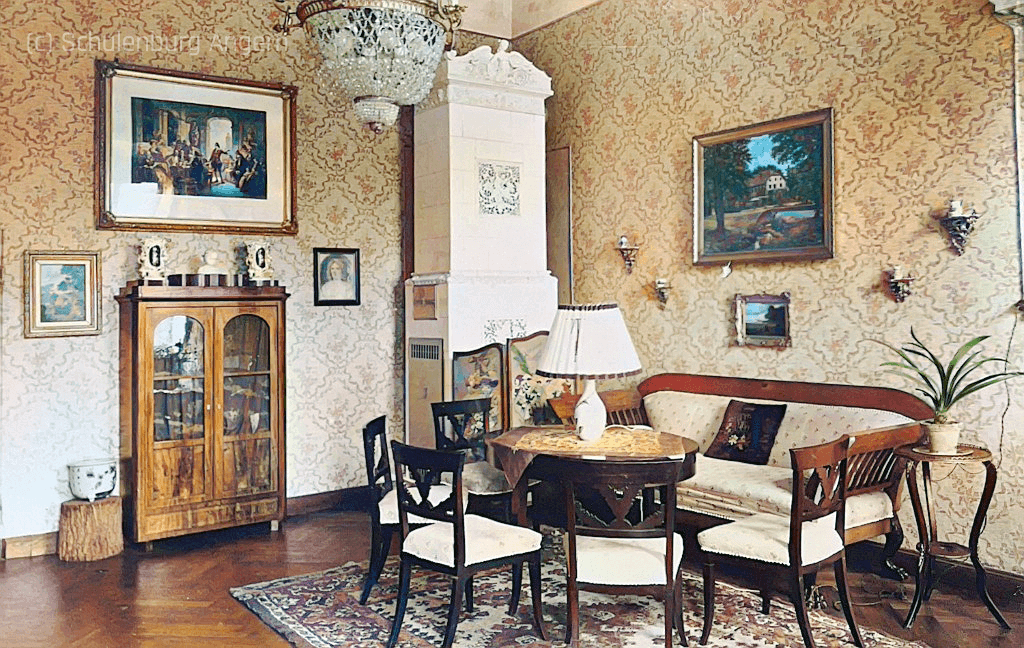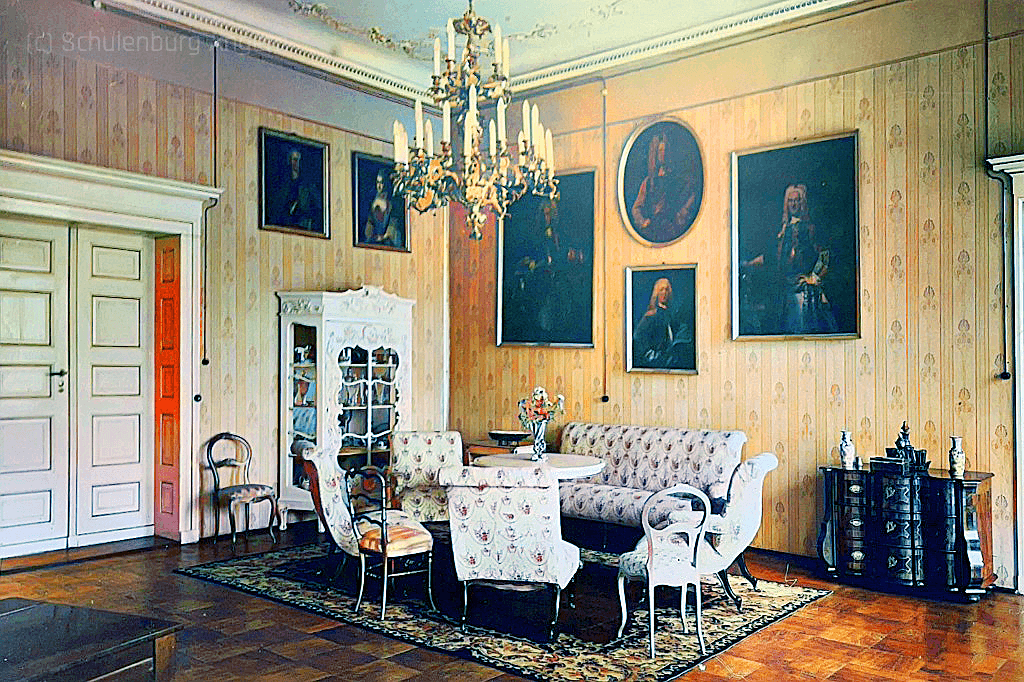Geschichtlicher Überblick
Das Wasserschloss Angern blickt auf eine über 700-jährige Geschichte zurück und war Sitz des altmärkischen Uradelsgeschlechts von der Schulenburg – ein Ort politischer Macht, wirtschaftlicher Entwicklung und kultureller Repräsentation vom Mittelalter bis ins 20. Jahrhundert.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Das Rittergut Angern: Kontinuität, Wandel und Enteignung eines schulenburgischen Familienbesitzes. Das Rittergut Angern in der Altmark, einem Teil des heutigen Sachsen-Anhalt, zählt zu den ältesten (fast) durchgehend von einer Familie bewirtschafteten Rittergütern Deutschlands. Es befindet sich seit 1448 im Besitz der Familie von der Schulenburg, einem weit verzweigten brandenburgisch-preußischen Adelsgeschlecht, das nicht nur durch militärische und politische Ämter hervortrat, sondern auch durch seine standesherrliche Besitzkultur. Über Jahrhunderte hinweg spiegelte sich in der Geschichte des Ritterguts die politische, wirtschaftliche und soziale Entwicklung des deutschen Adels. Das Gut wurde im 18. Jahrhundert durch den sardinischen General Christoph Daniel von der Schulenburg zu einem Fideikommiss erhoben – einer juristischen Form, die den ungeteilten Erhalt des Familienbesitzes sichern sollte. Die Geschichte Angerns steht exemplarisch für adelige Herrschaftsstrukturen, deren Auflösung im 20. Jahrhundert mit der Bodenreform in der sowjetischen Besatzungszone ihr jähes Ende fand.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Angern und Wenddorf, zwei im Kreis Wolmirstedt (heute Bördekreis) gehörige Dörfer, liegen unweit des Südrandes der Altmark. Die Dorfstätten erheben sich etwa 120 m über dem Meeresspiegel. Die Feldmarken sind von vielen Gräben durchzogen; Acker, Wiese, Wald wechseln in wohltuender Weise miteinander ab.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Die Gründung des Ortes Angern ist nicht durch schriftliche Zeugnisse belegt. Allerdings war die Gegend bereits in der Jungsteinzeit besiedelt, worauf zahlreiche Bodenfunde hinweisen. Erste Siedlungen in der Region wurden von den Angeln errichtet.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Im Jahr 1336 verzichtete Markgraf Ludwig I. von Brandenburg auf mehrere Ortschaften, darunter Angern, das fortan nicht mehr zur brandenburgischen Altmark, sondern zum Erzbistum Magdeburg gehörte. Damit erneuerte der Erzbischof die Belehnung der Markgrafen mit den erzbischöflichen Gütern in der Altmark, wobei Wolmirstedt, Alvensleben, Rogätz, Angern und die Grafschaft Billingshoch ausdrücklich als Besitzungen des Erzstifts Magdeburg anerkannt wurden. Für den Erzbischof und seine Nachfolger gingen damit alle Ansprüche auf Angern und andere nördlich der Ohre gelegene Ortschaften an das Erzstift Magdeburg über. Dies stellt zugleich die erste urkundliche Erwähnung des Ortes Angern dar.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Die Urkunden der nächsten Zeit nennen nur Pfandinhaber von Angern: 1392 und 1403 die von Rengerslage, 1411 Sander von Hermersdorf und 1424 Dieter von Zerbst.
Am 19. März 1424 gelangten der kurfürstliche Rat und Hauptmann der Altmark Bernhard (IV) von der Schulenburg sowie sein Bruder Werner in den Pfandbesitz der Burg Angern, die der Erzbischof Günther von Magdeburg ihnen und Dieter von Zerbst für 400 Rheinische Gulden verpfändete.
Anno 1448 erwarben die drei Söhne Busso, Bernhard und Matthias des Stammvaters der "weißen Linie", Fritz (I) von der Schulenburg, die Burg Angern für 400 Rheinische Gulden und 60 alte Schock Groschen von Albrecht von Zerbst. Sie erhielten durch Lehnbrief des Erzbischofs Friedrich von Magdeburg das Recht auf männliche Erbfolge. Diese Brüder sind die Stammväter der weißen Linie des Schulenburg'schen Geschlechts: Busso für den älteren, Bernhard für den mittleren und Matthias für den jüngeren Ast.
Jede der drei Linien besaß ursprünglich einen eigenen Gutsanteil: Der ältere Ast übernahm mit Busso die Vergunst, einen Rittersitz außerhalb des Dorfes; der mittlere und der jüngere Ast teilten sich die Burg und hatten jeweils getrennte Gutshöfe.
Der Streit zwischen den Erzbistümern Brandenburg und Magdeburg wurde am 12. November 1449 im Zinnaischen Vergleich beigelegt. Dabei fiel Angern endgültig an das Erzstift Magdeburg, das 1680 als Herzogtum Magdeburg an Brandenburg überging und 1816 Teil der preußischen Provinz Sachsen wurde.
Seit 1448 gehörten die Dörfer Angern (mit Ortsteil Vergunst) und Wenddorf sowie die wüsten Feldmarken Kastel, Palnitz und Mackedal, später auch Bülitz und Hörsicht, zum Rittergut. Zeitweise wurden auch die Güter Kehnert, Hohenwarsleben, Schricke, Farsleben, Detzel, Ramstedt und Ìtz von Angern aus verwaltet.
Bis zur ersten lutherischen Kirchenvisitation von 1562 bis 1564 wurde Angern kaum erwähnt, meist nur im Zusammenhang mit der Burg. Ab 1558 finden sich erste Aufzeichnungen über das Dorf, das zu jener Zeit 56 Familien zählte.
- Details
- Kategorie: Geschichtlicher Überblick
Anno 1567 wird das Lehen auf die weiße Linie des Geschlechts als Fideikommiss übertragen, was bedeutet, dass der Besitz auch nach dem Tod des Lehnsinhabers in der Familie verbleibt und nicht an den Erzbischof zurückfällt. Fortan wurden in Angern drei Güter geführt: 'Alt Hansens Teil', Gut Vergunst sowie der Burghof. Die drei Brüder vererbten ihre Güter jeweils an ihre erstgeborenen männlichen Nachkommen.
Busso (ältere Linie) erhält das Gut Vergunst. Der mittlere und jüngere Zweig teilen sich die Burg, besitzen jedoch getrennte Gutshöfe.
Bernhard (mittlere Linie) erhält den alten Hof neben der Kirche. Der Urenkel von Busso I - Busso VI. (1550-1601) - verarmte völlig und geriet in Konkurs, sein Anteil wurde von seinen Gläubigern in Besitz genommen. Erst sein Sohn Hans XII. konnte den Besitz 1602 zurückkaufen. Daher rührt der Name ,Alt Hansens Teil'.
Matthias (jüngere Linie) erhält den Burghof. Vererbt wird er jeweils an den erstgeborenen männlichen Nachkommen. Diese sind Bernhard (XI) (1470-1500), Matthias (III) (1506-1542) und Frh. Daniel (1538-1594).
Ab anno 1515 ist er im Besitz von Jakob II von der Schulenburg. Durch den Kriegsdienst hatte Jakob ein großes Vermögen erworben, es gelang ihm aber nicht, seinen Erben ein weiteres Gut zu sichern. Er vergrößerte daher 1561 den Anteil seiner Linie an Angern durch Kauf der Hälfte des Anteils der mittleren Linie von Christoph III (Nr. 170).
Nach Frh. Daniel übernimmt Henning (III) (1587-1637) den Burghof und hat die Gräuel des 30 jährigen Krieges in hohem Maße zu tragen. Angern gerät 1631 zwischen die Fronten der kaiserlichen Truppen unter General Tilly und der schwedischen Armee. Eine Abteilung seiner Soldaten hatte die Burg in Angern besetzt, wurde jedoch nach kurzem aber heftigem Gefecht in die Flucht geschlagen. Bei dem anschließenden Brand des Dorfes kommt auch die Burg zu Schaden. Einige Jahre hindurch befindet sich keine lebende Seele am Ort. Wegen Mangels an Menschen ist an Ackerbestellung nicht zu denken. Trotzdem wohnt der Gutsherr Henning (III) mit seiner Familie bis zu seinem Tode weiterhin in Angern und nimmt auch noch die große Familie seines Bruders Matthias bei sich auf, als dieser vor den kaiserlichen Soldaten und der Pest aus Altenhausen fliehen muss.